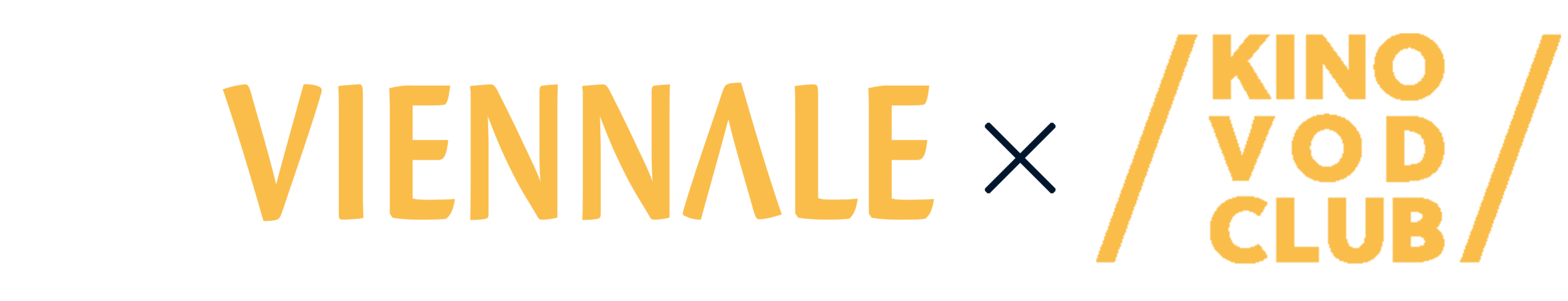Gib hier den Code ein, den du erhalten hast:
Gastón Solnicki - im Interview
Der 1978 in Buenos Aires geborene Filmemacher studierte am International Center of Photography und an der Tisch School of the Arts in New York. The Souffleur feiert bei der Viennale seine Österreichpremiere. Auch sein Film A LITTLE LOVE PACKAGE, den ihr bei uns streamen könnt, war vor drei Jahren in Wien zu sehen. Kürzlich wurden all seine Werke vom MoMA in New York erworben.
In deinem neuen Film geht es um ein Hotel, das langsam verschwindet, und um einen Mann, der sich in einer verändernden Welt behaupten muss. Wie bist du zu dieser Geschichte gekommen – und warum spielt sie in Wien?
Der Film ist Teil einer Trilogie, die nie als Trilogie geplant war. Keiner meiner Filme entsteht aus einem fixen Drehbuch. Ich komme aus dem Dokumentarfilm, und oft sind es Menschen, Orte oder bestimmte Atmosphären, die mich anziehen und einen Film formen. Wien ist für mich ein sehr besonderer Ort – nicht zufällig, sondern aufgrund meiner persönlichen Geschichte: Meine Familie stammt aus Europa und emigrierte nach dem Krieg. Wien war zwar nie meine Heimat, aber ich habe mich der Stadt immer nahe gefühlt. Als ich dann tatsächlich hier gearbeitet habe, habe ich gespürt, wie fremd und gleichzeitig vertraut Wien für mich ist. Es gibt viel Nähe, aber auch eine große Distanz und Kälte – und genau diese Spannung interessiert mich. Das Hotel wurde schließlich eine Art Strategie, um diese Themen zu bündeln: Ein Ort mit Geschichte, mit Archiven, mit Menschen, die dort seit Jahrzehnten arbeiten… Ein lebendiger Organismus.
Eine zentrale Figur ist Willem Dafoe. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit?
Willem war für mich immer präsent. Ich habe ihn oft auf Festivals gesehen, aber kennengelernt habe ich ihn erst, als Introduzione all’Oscuro lief. Wir kamen ins Gespräch, er war sofort sehr offen, interessiert und neugierig. Unsere Beziehung hat sich über Jahre entwickelt. Natürlich ist es für jede:n Filmemacher:in ein Traum, mit einem Schauspieler wie ihm zu arbeiten, und ich habe gesehen, dass er sich bewusst in Projekte begibt, die abseits von Hollywood liegen – er arbeitet mit Abel Ferrara und vielen anderen unabhängigen Filmemacher:innen weltweit. Willem ist extrem großzügig und bereit, sich auf riskante Prozesse einzulassen. Unser Film ist also das Ergebnis einer Freundschaft, die langsam gewachsen ist.
Viele deiner Filme – auch dieser – scheinen Momente des Übergangs einzufangen: Phasen zwischen einer alten und einer neuen Welt, zwischen Verfall und Aufbruch. Warum fasziniert dich dieses „Dazwischen“ so?
Weil das Dazwischen vielleicht das Wahrhaftigste ist. Ich interessiere mich sehr für Ambiguitäten, Spannungen, Paradoxien. Klare Kategorien sind oft Konstrukte – das Leben passiert in den Übergängen. Kino kann diese Räume spürbar machen. Das ist etwas, das mich ständig beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Menschen, die durch schwierige Zeiten gehen, abesonders empfindlich dafür sind. Wir alle leiden und kämpfen – und genau diese Ambiguität, diese Nonlinearität berührt uns auf einer tieferen Ebene. Kino kann das auf seine Art ausdrücken, genauso wie Musik. Für mich ist das eine Art zu arbeiten, nicht nur eine Technik.
Du arbeitest auch ohne festes Skript, was bedeutet das für die Filme?
Ich schätze sehr, was Jonas Mekas sagt: „Improvisation ist die höchste Form der Konzentration.“ Improvisation kann man nicht vortäuschen. Sie hat oft einen schlechten Ruf – gerade in Argentinien – aber man kann nicht alles strikt durchplanen. Das unterscheidet sich auch von der österreichischen Arbeistweise, wo oft viel Druck herrscht und Menschen oder Situationen oftmals steif sind. Also verglichen mit der italienischen Community, in der ich lebe und aufgewachsen bin. Aber auch hier verschwimmen die Grenzen. Und dann gibt es diese kleinen alltäglichen Dinge, zum Beispiel das Schnitzel: In Italien nennt man es „Milanesa“. Wenn wir über Oxymora sprechen, haben wir in Argentinien die „Milanesa Napolitana“ – der Name selbst ist absurd, aber es ist sehr beliebt: ein Schnitzel mit Käse, Tomaten, Schinken, manchmal sogar mit Pasta oben drauf. Total redundant, aber es ist Alltag. Es ist erstaunlich, wie weit alles auseinander liegt und doch so tief miteinander verbunden ist.
Architektur, Musik und Städte spielen in deinen Filmen eine besondere Rolle. In diesem Film wirkt Wien selbst wie ein Schauspieler.
Ja, absolut. In diesem Film ist es besonders stark ausgeprägt – nicht unbedingt Wien als Stadt, sondern als ein spezifisches Gebäude. Ich arbeite viel mit Musik, Architektur und den Menschen, die dort leben und arbeiten – das alles entfaltet in meiner Arbeit eine eigene Kraft. Es geht mir nicht darum, traditionelle Erzählstrukturen zu verweigern, sondern andere Tiefen und Strategien zu erschließen – eine sehr persönliche Art von Narration, die Emotion und Kommunikation einschließt. Ich möchte mit meinen Filmen niemanden langweilen oder foltern. Natürlich erwarten manche von Anfang an etwas anderes, das bringt auch ein großer Name wie Willem Dafoe mit sich. Aber wenn man sich auf diese Wellenlänge einlässt, öffnet sich ein Universum voller Zartheit, Humor und Intensität, das die Zuschauer:innen berührt. Gerade heute, wo vieles algorithmusgesteuert ist und auf Bekanntes reduziert wird, finde ich Werke interessant, die eine größere Bandbreite an Reaktionen erlauben. Ich arbeite neben Willem mit einem Team aus nicht-professionellen Schauspieler:innen, die sich vollkommen für das öffnen, was ich mache. Diese persönliche Beteiligung, die Mischung aus Risiko, Großzügigkeit und kleinen, oft verrückten Momenten ist die treibende Kraft meiner Arbeit. Auch Willem war anfangs ein wenig ängstlich und sagte zu mir, dass er nicht jeden Tag ein Kaninchen aus dem Hut zaubern kann. Verständlich, weil meine Arbeitsweise sehr improvisiert ist, es gibt kein festes Drehbuch und jeder Tag verlang Spontaneität. Das überrascht viele, selbst wenn sie meine Filme schätzen. Sobald sie Teil davon sind, meinen sie, es wäre verrückt. Gerade für größeren Team kann das sehr herausfordernd sein. Aber genau dadurch bleibt die Arbeit letztlich so lebendig und frisch.
Deine Filme bewegen sich oft zwischen Dokumentarischem und Fiktion. Wo ziehst du die Linie?
Ich versuche gar nicht, eine klare Linie zu ziehen – im Gegenteil, ich möchte sie verwischen. Jean-Luc Godard hat einmal gesagt: „Méliès drehte Dokumentarfilme über Zirkusartisten, und die Lumière-Brüder machten Fiktionen über die Fabriksarbeiter.“ Ich finde das sehr treffend. Für mich steckt in jedem Film beides, das Dokumentarische und die Fiktion. Ich hatte nie das Bedürfnis, innerhalb starrer Kategorien zu arbeiten – warum sollte man etwas verschließen, wenn man es öffnen kann?
Planst du, nach dieser Trilogie weiter in Wien zu drehen oder ist das Kapitel abgeschlossen?
Im Moment fühlt es sich wie eine abgeschlossene Phase an. Einen Film in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent und in einer anderen Kultur zu drehen, ist eine große Herausforderung. Ich sehne mich danach, wieder in einer Stadt drehen, in der ich mein eigenes Bett, meine Katze und meinen eigenen Kaffee habe. Aber natürlich ist es nie ausgeschlossen, dass ich zurückkehre. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass dieser Zyklus rund und abgeschlossen ist. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder in Argentinien zu drehen – dort, wo ich lebe. Aber wer weiß…
Deine Filme laufen seit Jahren regelmäßig auf der Viennale. Was bedeutet dieses Festival für dich?
Sehr viel. Seit 2008 war ich regelmäßig hier und für mich war die Viennale immer ein Ort, an dem Kino nicht auf Glamour oder Markt reduziert wird. Es gibt keine roten Teppiche, keinen Wettbewerb, sondern eine echte Neugier und ein echtes Fest für das Kinos. Das ist selten geworden. Für mich fühlt sich die Viennale fast wie ein Zuhause an.
Gastón Solnickis Film A LITTLE LOVE PACKAGE steht euch im Rahmen unseres V’25 Blickpunkt-Programms als Stream zur Verfügung.